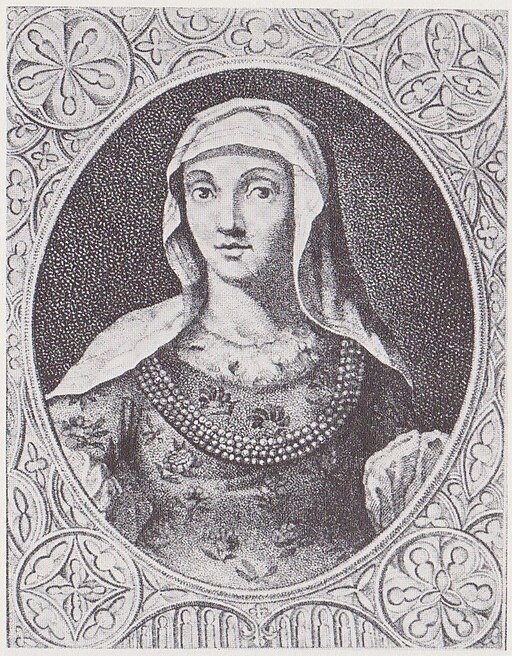Als ich damals für „Die letzte Fehde an der Havel“ recherchierte, war ich fasziniert vom Stand der Kaufleute und Krämer. In den aufstrebenden Städten des Mittelalters erreichten sie mit ihrem Reichtum etwas, das dem Bürgertum bzw. dem dritten Stand bislang verschlossen geblieben war: Einfluss, Macht und Wohlstand. Man denke nur an die Fugger, die es mit den Großen der damaligen Welt aufnehmen konnten. Wenn wir heute durch eine vom Krieg größtenteils verschonte Innenstadt schlendern, dann sind es meist die Häuser der Kaufleute, die uns innehalten und staunen lassen. Drei, vier Stockwerke sind sie hoch, aufwändig verziert – ja, beinah protzig und zweifellos selbstbewusst.
Stralsund ist so eine Stadt, die vom Krieg relativ verschont geblieben ist. Dank ihres reichen Erbes an sogenannter Backsteingotik zählt sie zum UNESCO-Weltkulturerbe. Grund genug also, das Stadtmuseum aufzusuchen – nur leider war dieses während unseres Besuchs vor ein paar Wochen größtenteils geschlossen. Aber eines der Häuser war geöffnet: ein 700 Jahre altes Krämerhaus.
Man muss wissen, dass Krämer nicht gleich Kaufleute sind, auch wenn die Ausdrücke oft synonym verwendet werden. Ein Kaufmann war jemand, der mit Waren über weite Distanzen handelte, oft von Business zu Business. Ein Krämer hingegen verkaufte direkt an den Kunden und unterhielt zu diesem Zweck ein günstig gelegenes Haus – direkt am Markt oder nicht weit davon entfernt.
Nicht viel lässt erahnen, dass das Haus in der Mönchstraße 38 in Stralsund ein solches Alter auf dem Buckel hat. Das liegt vor allem daran, dass es zwei Vorbauten hat, in denen unter anderem ein Buchgeschäft angesiedelt ist. Aber wenn man dazwischen hindurchgeht, steht man plötzlich in einer Diele aus der Zeit des Barock. Eine Diele war eine Art Einfahrt, wo man be- und entladen konnte. Später kamen bei diesem Haus Einbauten hinzu, zum Beispiel ein Klosett (ja, genau, fürs andere „Geschäft“) und eine verglaste Kammer, die etwa als Logierzimmer gedient haben könnte.
Hier bekommt man zunächst ein, zwei kurze Filme gezeigt, denn dass das Haus nach all der Zeit (und der DDR) überhaupt noch steht, grenzt an ein Wunder – und ist vor allem einer sehr umsichtigen und aufwändigen Denkmalpflege zu verdanken. Hier erfährt man auch, dass das Haus zeitweise von bis zu sieben Parteien bewohnt war. Angesichts des baufälligen Zustands Ende der 1990er-Jahre ist das kaum vorstellbar.
Doch zurück ins Mittelalter: Wie wir bei unserem Besuch erfuhren, lebten die ersten Besitzer des Hauses nicht im Gebäude selbst, sondern in einem Anbau im Hof. Das ist umso erstaunlicher, wenn man sich die Größe des Hauses vor Augen hält: Hier konnten Waren auf ganzen sechs Etagen gelagert werden. So groß wirkt das Haus von außen gar nicht – aber das liegt daran, dass im Dachgeschoss die Stockwerkhöhe massiv nachlässt.
Das mittelalterliche Wohnhaus der Familie existiert heute nicht mehr (an seiner Stelle befinden sich nun ein Treppenhaus als Fluchtweg sowie die Sanitäranlagen), dafür kann man im Haupthaus sehen, wie die jeweilige Besitzerfamilie in der Biedermeierzeit gelebt hat – inklusive Schwarzküche, guter Stube, Arbeitszimmer und etlichen Lagen von Tapeten.
Darüber beginnt dann der Dachstuhl – ganze vier Etagen davon. Man muss sich als Besucher schon ein wenig trauen, die engen Stiegen hochzukraxeln, um ganz nach oben zu gelangen. Doch der Aufstieg lohnt sich: Das Haus verfügt bis heute in seinem Zentrum über einen mittelalterlichen Lastenkran, mit dem mittels eines verschließbaren Schachts Waren nach oben gehievt werden konnten.
Ein eindrucksvoller Zeitzeuge über die Jahrhunderte. Ich konnte natürlich nicht widerstehen und habe mir ein Büchlein mitgenommen, das die Geschichte, den Aufbau und die Restaurierung des Gebäudes näher beleuchtet.
Fazit: Für Mittelalterfans, die Stralsund (oder Rügen) besuchen, ein absolutes Muss.